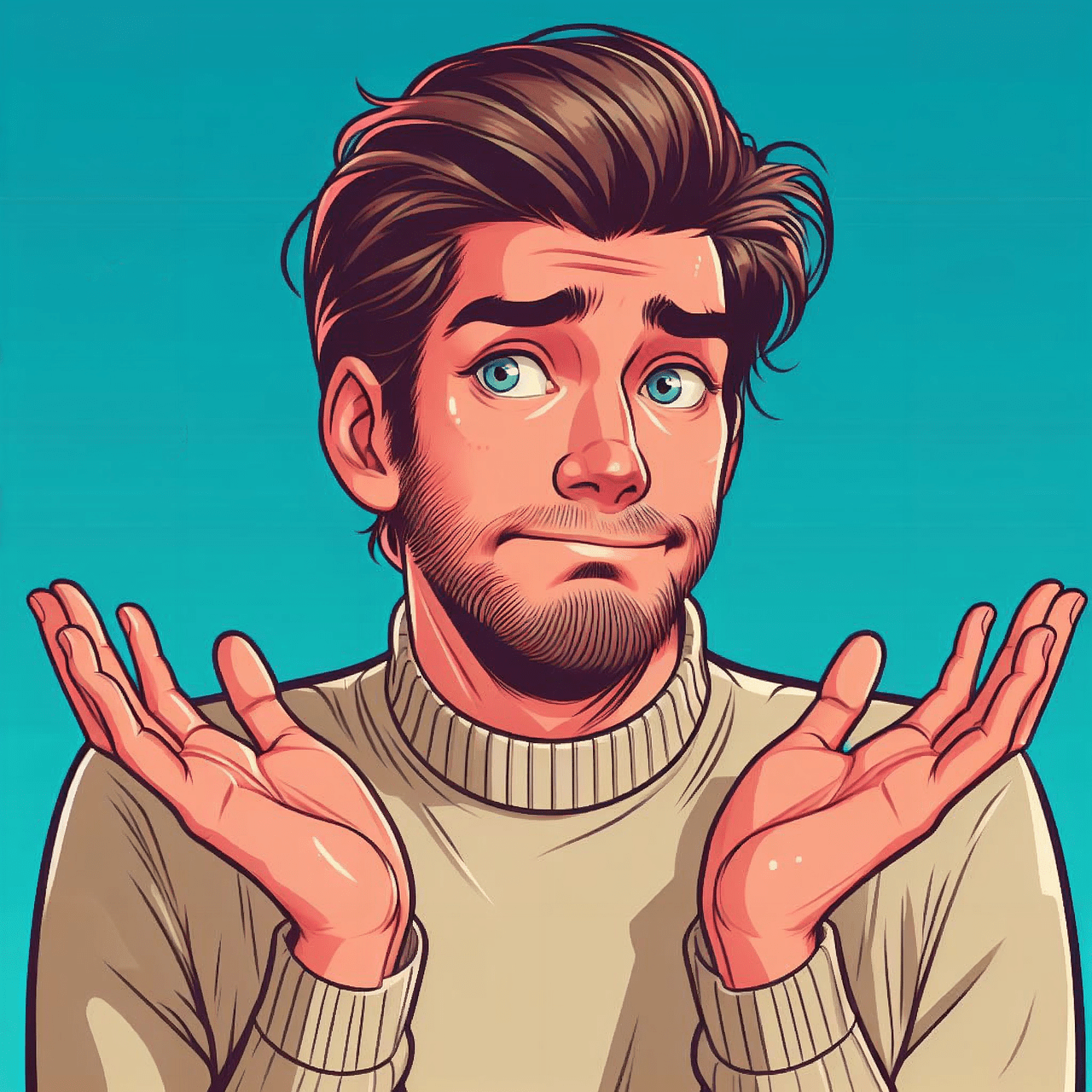„Wir benötigen mehr Studien zu Langzeitverläufen behandelter Jugendlicher“, fordert Kinder- und Jugendpsychiater Georg Romer, der Koordinator der höchst umstrittenen Transgender-Leitlinie, gegenüber dem Deutschen Ärzteblatt. Das ist bemerkenswert!
Denn es handelt sich um eine sogenannte S2K-Leitlinie, das heißt, die beteiligten Ärzte und Fachverbände haben zu einer gemeinsamen Meinung, einem Konsens, gefunden. Wissenschaftliche Studien, die ihre Meinung unterstützen würden, können sie jedoch nicht vorweisen. Es gibt keine Evidenz.
Die zentrale Behandlungsempfehlung der Leitlinie lautet: Jugendliche, die sich als „trans“ identifizieren und eine transgender-medizinische Behandlung mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen wünschen, sollen diese auch erhalten.
Also: Pubertätsblocker, Hormontherapie und Brustamputation.
„Erst schießen, dann fragen“
Es wäre unethisch, die Selbstdiagnose der betroffenen Jugendlichen in Frage zu stellen und ihnen ihre Transitionswünsche zu verweigern. In einem Satz: Minderjährige sollen selbst bestimmen. Ob eine biologische Frau nach zehn Jahren Hormontherapie als Transmann von Ende zwanzig immer noch glücklich mit ihrer damaligen Entscheidung ist, ist eine andere Frage. Dieses Frage sollten sich Ärzte aber stellen, bevor sie eine Leitlinie veröffentlichen, die beansprucht, medizinische Standards zu setzen. Romer vertritt eher das Motto „Erst schießen, dann fragen“:
Wir müssen demnach bei medizinischen Behandlungsentscheidungen, die in die körperliche Entwicklung von Jugendlichen eingreifen, deren Schutz vor verfrühten Entscheidungen bedenken, aber gleichzeitig ihr Selbstbestimmungsrecht über ihre Geschlechtsidentität und mögliche gesundheitliche Nachteile berücksichtigen, wenn wir ihrem Behandlungswunsch nicht oder zu spät folgen.
Im Zweifel soll der Wunsch einer pubertierenden Jugendlichen gelten. Und das ohne wissenschaftliche Grundlage. Die Leitlinie ist veröffentlicht und gültig. Wenn Romer also nun Langzeitstudien fordert, stellt er im Grunde den Konsens der Leitlinie in Frage: Es könnte ja auch sein, dass die Studien ergeben, dass die Entscheidung zur Geschlechtsangleichung oftmals verfrüht war und die Betroffenen später sehr darunter leiden.
Wie viele 26-Jährige bedauern es, dass sie mit 16 keine Geschlechtsangleichung haben durften?
Alle Beteiligten seien sich darin einig gewesen, „dass wir mehr Studien zu Langzeitverläufen behandelter Jugendlicher benötigen“, betont Romer. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch alle Beteiligten nicht die Hand dafür ins Feuer legen wollten, dass die nie wieder rückgängig zu machende Behandlung für die jungen Patienten die richtige Entscheidung ist.
Warum empfiehlt man die Behandlung dann trotzdem für den gesamten deutschsprachigen Raum? Warum erlaubt man die Transgender-Behandlung für Jugendliche dann nicht nur, wie in anderen Ländern, im streng reglementierten Rahmen wissenschaftlicher Studien? Oder untersagt sie am besten ganz! Warum leitet man nicht erst einmal eine Langzeitstudie in die Wege, die nach zehn Jahren die inzwischen erwachsen gewordenen jungen Frauen befragt, ob sie es sehr bedauern, dass sie mit 16 Jahren die medizinische Angleichung zum Trans-Jungen nicht durchführen konnten.
Für die Vergabe von Pubertätsblockern gibt es solche Studien bereits. Fast alle Kinder, die nicht mit Pubertätsblockern behandelt wurden, konnten sich im Laufe ihrer Pubertät wieder mit ihrem biologischen Geschlecht aussöhnen. Auch deshalb haben viele Länder die Pubertätsblockade für junge Trans-Patienten untersagt.